
Aktionswoche gegen Rassismus 2024
Dank der finanziellen Unterstützung der kantonalen Fachstelle Integration und Antirassismus und der eidgenössischen Fachstelle für Rassismusbekämpfung organisiert Radio X im Rahmen der Aktionswoche gegen Rassismus vom 18. bis 24. März 2024 die Auftaktveranstaltung zum Thema Alltagsrassismus sowie ein vielseitiges Radioprogramm.
Podiumsdiskussion über Alltagsrassismus am Montag, 18. März ab 18h im kHaus
mit einer Begrüssung von Jenny Pieth (Co-Leiterin der Fachstelle Integration und Antirassismus), Inputreferat Danielle Isler (Sozialwissenschaftlerin Universität Bayreuth), Podiumsdiskussion mit Stéphane Laederich (Rroma Foundation), Guilherme Bezerra (brasilianischer Medienschaffender) und Danielle Isler. Moderiert von Elisa da Costa (Gründerin Blackfluencers und Afrokaana). Anschliessend Fragen aus dem Publikum plus Apéro.
Darüber hinaus bietet Radio X in der Aktionswoche ein randvolles Radioprogramm mit antirassistischen Beiträgen:
Mo, 18.3.: Info, was in der Aktionswoche ansteht
Di, 19.3.: Antisemitismus
Mi, 20.3.: Rassismus im Cosplay
Do, 21.3.: Sans Papier - eine Stimmungsaufnahme
Fr, 22.3.: FCB-Antirassismuskampagne
Sa, 23.3.: Racial Profiling
So, 24.3.: Rassismus auf der Wohnungssuche
Zudem arbeiten viele Partnerorganisationen in Kooperation mit der kantonalen Fachstelle Integration und Antirassismus:


Kontakt
Social Media
Mit der finanziellen Unterstützung von:

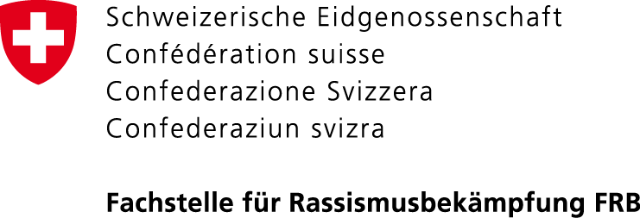

It's Fair not Fast-Fashion
Fast Fashion ist ein globales Problem, das auch die Schweiz betrifft. Massenhaft bestellen viele Konsument:innen Kleider, die sie nach kurzer Zeit in die Altkleidersammlung geben. Die fair fashion factory möchte der Region einen anderen Weg anbieten. von Malik Iddrisu
Fair Fashion
Und wie viele Kleider wirfst du jedes Jahr weg? 110'000 Kleider wirft die Schweiz jährlich in die Altkleidersammlung. Dabei ist ein Grossteil dieser Kleider noch in sehr gutem Zustand, wie diverse Studien zeigen. Von der Altkleidersammlung wandern die Kleider meistens nach Asien oder Afrika. Transportwege wie solche führen dazu, dass grosse Mengen an CO2 augestossen werden. Der Basler Verein fair fashion factory möchte diese langen Transportwege von Kleidern einschränken. Das siebenköpfige Team aus Textilschaffenden will zum Einen dafür sorgen, dass Altkleider länger getragen oder lokal verarbeitet werden. Weiter setzen sie sich dafür ein, dass sich langfristig eine lokale Kleiderproduktion entwickelt, die umweltfreundlich ist.
5 Tonnen Kleider
Die fair fashion factory arbeitet als Netzwerk, das zahrleiche Händler:inen und Designer:innen dabei unterstützt, nachhaltig mit Kleidern zu arbeiten.
Ein Projekt, das Anfang dieses Jahres auch medial präsent wurde, ist die Machbarkeitsstudie zu den Basler Altkleidern. In diesem Rahmen sortierte die fair fashion factory fünf Tonnen Altkleider, um herauszufinden, wie viele davon noch getragen werden können. Dies mithilfe von freiwilligen Helfer:innen. Leandra Michel ist Projektmanagerin und Mitglied der fair fashion factory. "Es hat sich gezeigt, dass man viele der Kleider noch tragen kann und ein Interesse bei den Leuten besteht, diese weiter anzuziehen", sagt sie.
Zukünftig ist eine weitere Sortieraktion geplant, in welcher die Kleidungsstücke nach Art sortiert werden. Langfristig soll eine Zusammenarbeit mit Secondhändler:innen entstehen, welche einen Teil der Altkleider in ihr Sortiment aufnehmen.
Lokale Produktion
Warum Kleider von einem anderen Kontinenten kaufen, wenn man diese in der Region produzieren kann? Diese Überlegung machte die fair fashion factory und begann, einen Produktionsort für Kleider einzurichten. So sei es auch möglich, erst dann zu produzieren, wenn Kund:innen auch effektiv bestellen und die Kund:innen wüssten dann, aus welchem Material produziert werden. Geschehen soll dies in Form einer Strickfabrik mit modernen Strickmaschinen. Die fair fashion factory will die Strickfabrik interessierten Designer:innen zur Verfügung stellen, damit diese Strickprodukte zu verschiedenen Preisen herstellen können. Die Strickproduktion hätte folgenden Vorteil, dass sie wenig Abfall generiere und mit recyclebarem Garn gearbeitet werden könne. "Viel Wissen über die Textilproduktion ist hier verlorengegangen", sagt Pascal Heimann, Dozent für Textildesign und Mitglied der fair fashion factory. In Zusammenarbeit mit Designer:innen aus dem Ausland will die Factory dieses Wissen auf die Region übertragen.
Bei vielen Projekten der fair fashion factory wird die Zukunft zeigen, welchen Impact sie auf die Fashion-Industrie haben. Damit die Industrie ökologischer funktioniert, braucht es aber alle. Vereine, die sich wie die fair fashion factory für eine ökologischere Textilindustrie starkmachen, Designer:innen, die sich an deren Projekte beteiligen, sowie die Konsument:innen, die ökologisch Kleider konsumieren.




.png/jcr:content/magnolia-medium.png)

