Schwarz/Weiss 2023
Schwarz/Weiss ist das Radio X-Format, welches sich mit den Beziehungen Basels mit Afrika auseinandersetzt. Die sechste Ausgabe widmet sich der Basler Kolonialgeschichte, der Basler Rolle im Sklavenhandel und den aktuellen Diskursen zu Restitution und Wiedergutmachung. Ein breit aufgestelltes Team – unter ihnen der Musiker Manuel Gagneux und eine grosse Zahl von Gästen ermöglicht die hintergründige Sendereihe, welche auch als Podcast angeboten wird. Start ist am 11. März.
“Stadt der Profiteure“ titelte unlängst das deutsche Magazin Geo – und meinte damit Basel, welches als Handelsstadt einen Teil seines Reichtums dem aktiven Mittun im Sklavenhandel verdankt. Davon zeugen die herrschaftlichen Sitze hoch über dem Rhein, die heute, wie das Blaue Haus, der Verwaltung dienen. Doch gibt es nicht nur steinerne Zeugen, sondern auch Nachkommen jener Familien. Zu ihnen gehört u.a. Leonhardt Burckhardt, Basler Politiker und Professor an der Universität, der auf Radio X sehr persönlich Auskunft über diese Erbschaft gibt.
Ganz unterschiedliche Familiengeschichten und damit ganz unterschiedliche Sichtweisen bringen die Basler Autoren Martin R. Dean und Nicolas Ryhiner mit ihren Werken „Meine Väter“ und „Im Surinam“ zum Ausdruck; sie treffen in einem Gespräch aufeinander.
Zum Stand der Geschichtsforschung geben die Historiker:innen Susanna Burghartz und André Salvisberg von Stadt.Geschichte.Basel Auskunft. Weitere Ausgaben von Schwarz/Weiss – Basler Kolonialgeschichte beschäftigen sich mit den Sammlungen der Basler Museen, der Qualität der aktuellen Wirtschaftsbeziehungen mit Afrika, und dem Blick, der von dort auf Basel geworfen wird.

Sendungen vom 11. März bis 3. Juni 2023
Die Schwarz/Weiss-Sendungen sind in folgende Schwerpunkte unterteilt:
1. Auftakt-Sendung: HörboX am 11. März (Wiederholung am 12. März)
2. Familiengeschichten mit kolonialem Hintergrund: Beitrag am 16. März
3. Der Basler Sklavenhandel: Beitrag am 23. März
4. Was findet sich in den Archiven?: Beitrag am 30. März
5. Gespräche mit Basler Familien: Beitrag am 6. April
6. Sammlungsprovenienzen & Benin Initiative Schweiz: Beitrag am 13. April
7. Heutige kulturelle Blicke und Austausch: Beitrag am 27. April
8. Rolle der Basler Mission: Beitrag am 4. Mai
9. Basels Handel heute: Beitrag am 11. Mai
10. Der Blick von Afrika auf Basel: Beitrag am 18. Mai
11. Brennpunkte und Forderungen der Gegenwart: Beitrag am 25. Mai
12. Schlussveranstaltung: HörboX am 3. Juni (Wiederholung am 4. Juni)
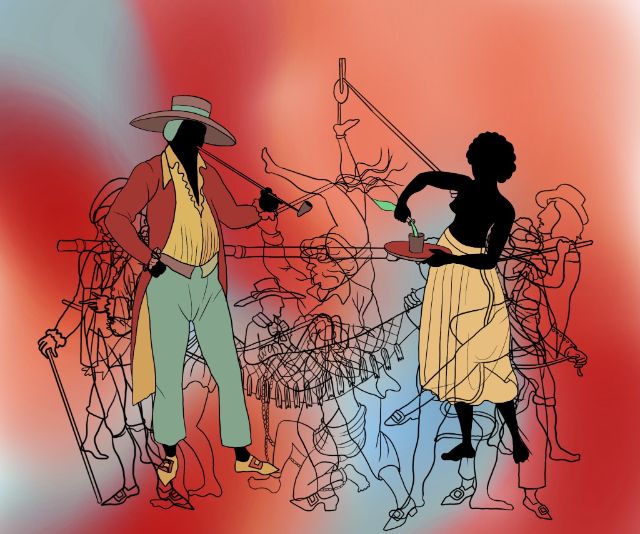
Projektteam, Kooperationen und finanzielle Unterstützung
Seitens Radio X sind Thomas Jenny, Danielle Bürgin, Janina Labhardt, Claire Micallef, Michaela Liechti, Mirco Kämpf und Paul von Rosen als Redaktionsteam unterwegs. Moderatorin ist Elisa Da Costa, Master-Studentin African Studies.
Das Artwork besorgte die Basler Künstlerin Sade Titilayo Hannah Fink, die Textildesign und Modedesign im Bachelor an der FHNW/HGK in Basel abschloss und nun Kunst & Vermittlung studiert.
Das Soundlayout zur Sendereihe wurde von Musiker Manuel Gagneux komponiert, dessen international gefeierte Band Zeal & Ardor das Thema musikalisch spiegelt.
Mit der freundlichen Unterstützung der Bürgergemeinde der Stadt Basel und der eidgenössischen Fachstelle für Rassismusbekämpfung.
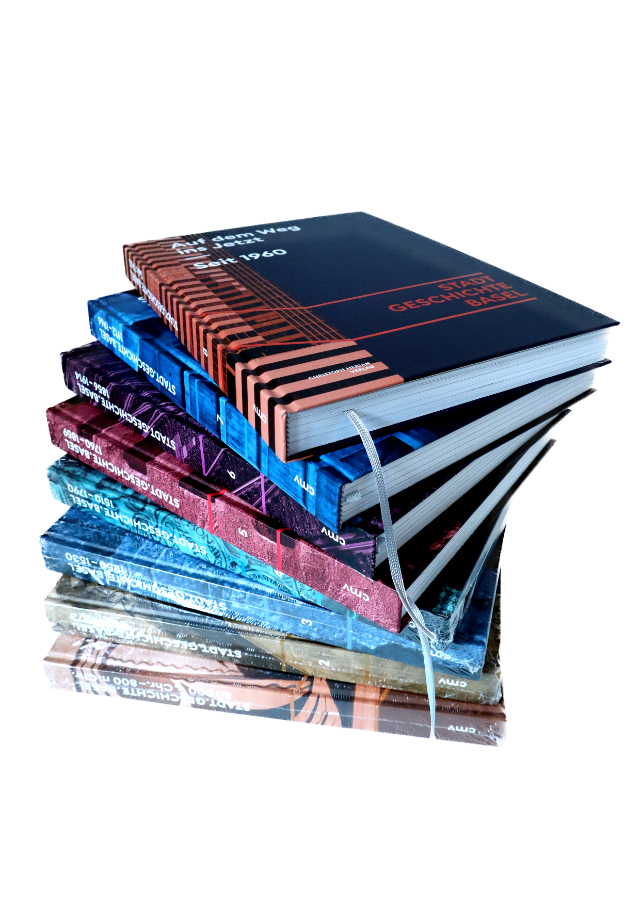
Stadt.Geschichte.Basel Podcast Folge 19
In der neunzehnten Folge des SGBS Podcast nehmen wir das Thema Migration und Bürgerrechtsvergabe unter die Lupe. Wir starten im 19. Jahrhundert bei der kantonalen Bürgerrechtsvergabe und schauen uns den Diskurs um Migrationsbewegungen an. Enden werden wir in den 1980er Jahren bei der Selbstorganisation von Migrant:innen in Basel. von Ben Haab
SGBS Folge 19 Migration
...
Bürgerrechte: Liberale vs. Bewahrer
Im 19. Jahrhundert war das Bürgerrecht in Basel stark umkämpft. Während 1779 noch über die Hälfte der Stadtbevölkerung Bürgerrechte inne hatten, sank dieser Anteil bis 1872 auf nur 27 %. Einbürgerungen waren selten, obwohl viele Zugezogene aus anderen Kantonen kamen. Jüdische Menschen, Katholiken und Frauen waren grundsätzlich ausgeschlossen.
Das Bürgerrecht stand für soziale Sicherheit, wirtschaftliche Chancen und politische Mitsprache. Liberale Kräfte forderten eine offenere Vergabepraxis. Konservative Bewahrer hingegen wollten Bürgerrechte einschränken. Ein Beispiel für eine restriktive Praxis ist der Flachmaler Johann Jakob Gross. Sein Einbürgerungsgesuch wurde 1850 abgelehnt – aus Angst vor mehr Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Der Fall zeigt, wie stark wirtschaftliche Interessen die Einbürgerungspolitik prägten.
Auch die liberalen Kräfte waren nicht unbedingt geprägt von einem gesellschaftlichen Öffnungsgedanke. Vielmehr ging es auch darum, der politischen Forderung nach einem allgemeinen Männerwahlrecht den Wind aus den Segeln zu nehmen. Erst mit der Bundesverfassung 1875 kamen grundlegende Reformen: Gewerbefreiheit und das Männerwahlrecht.
Arbeitsmigration im 20. Jahrhundert
In der Nachkriegszeit erlebte Basel einen wirtschaftlichen Aufschwung, besonders im Bauwesen. Um den Bedarf an Arbeitskräften zu decken, rekrutierte die Schweiz Menschen aus dem Ausland – vor allem aus Italien, später auch aus der Türkei. Viele kamen im Rahmen des restriktiven Saisonnier-Statuts, das nur neun Monate Aufenthalt erlaubte – ohne Integrationsperspektive.
Diese Politik belastete die Familien der Arbeitsmigrant:innen stark - und führte international zu Kritik. Erst in den 1960er Jahren ermöglichte ein Druck Italiens erste Schritte zum Familiennachzug.
Migrant:innen organisierten sich allerdings auch selber, um für ihre Rechte zu kämpfen. 1982 besetzten türkische Staatsangehörige in Basel beispielsweise eine Kirche. Sie protestierten damit gegen Ausschaffung in die Türkei, wo seit 1980 eine Militärdiktatur an der Macht war.
Das Saisonnier Statut blieb bis zur Jahrtausendwende in Kraft. 2002 hat die Schweiz die Personenfreizügigkeit übernommen.


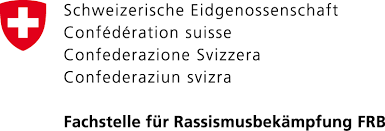
.png/jcr:content/magnolia-medium.png)

