Woche der Berufsbildung 2023
Ausgabe 2023
Die Woche der Berufsbildung ist die Weiterentwicklung des interkantonalen Tags der Berufsbildung, auch Radiotag genannt. Dieses Jahr beteiligen sich rund 30 Radiostationen und weitere Medien an der Woche der Berufsbildung und widmen sich entweder über die Woche verteilt oder konzentriert am Mittwoch, 10. Mai, der Berufsbildung.
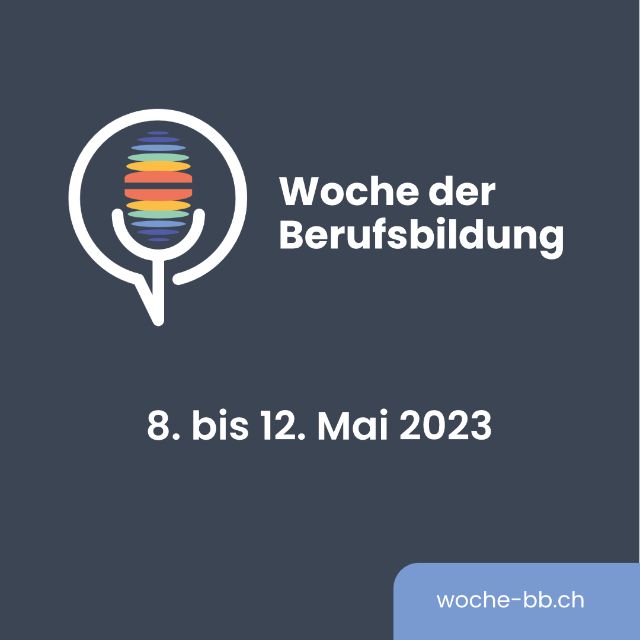
OnAir
Mittwoch 10. Mai 2023
07:15 Grussbotschaften der Bildungsdirektor:innen beider Basel: Monica Gschwind und Conradin Cramer
08:00 Dinge, die ich an meinem Beruf als Bäcker:in liebe
08:15 Monica Gschwind und Conradin Cramer zur Berufswahl
08:30 Mediamatik-Lernender Oliver McCarvil über seinen Beruf
09:00 Dinge, die ich an meinem Beruf als Betriebsinformatiker:in liebe
09:15 Interview mit Patrick Bosshard und Lernende Eva von Etavis
10:00 Dinge, die ich an meinem Beruf als Maurer:in liebe
11:00 Dinge, die ich an meinem Beruf als Metallbauer:in liebe
11:30 Christian Weiss und Thomas von Felten über die Berufswahl
12:00 Dinge, die ich an meinem Beruf als Elektroinstallateur:in liebe
12:15 Einblick in Pflegeberufe
13:00 Dinge, die ich an meinem Beruf als Chemielaborant:in liebe
13:30 Der Swiss Skills sechsplatzierte Lukas Jenny über seine Arbeit als Konditor:in
14:00 Dinge, die ich an meinem Beruf als Zimmermann/Zimmerin liebe
15:00 Anja Grönvold über die Lehrstellensituation in Basel-Stadt
15:30 Der Swiss Skills zweitplatzierte Lars Wenger über seine Arbeit als Motorradmechaniker:in
16:00 Interview mit Michael Konrad von der Gärtnerei Alabor
16:30 Bildungsdirektorin Monica Gschwind über ihren Berufsweg
17:15 Franziska Stocker zur Lehre als Buchhändler:in im Bider und Tanner
Kontakt
redaktion@radiox.ch
061 500 24 00
In Zusammenarbeit mit den Kantonen BL und BS und mit der Unterstützung von Berufsbildungplus.ch

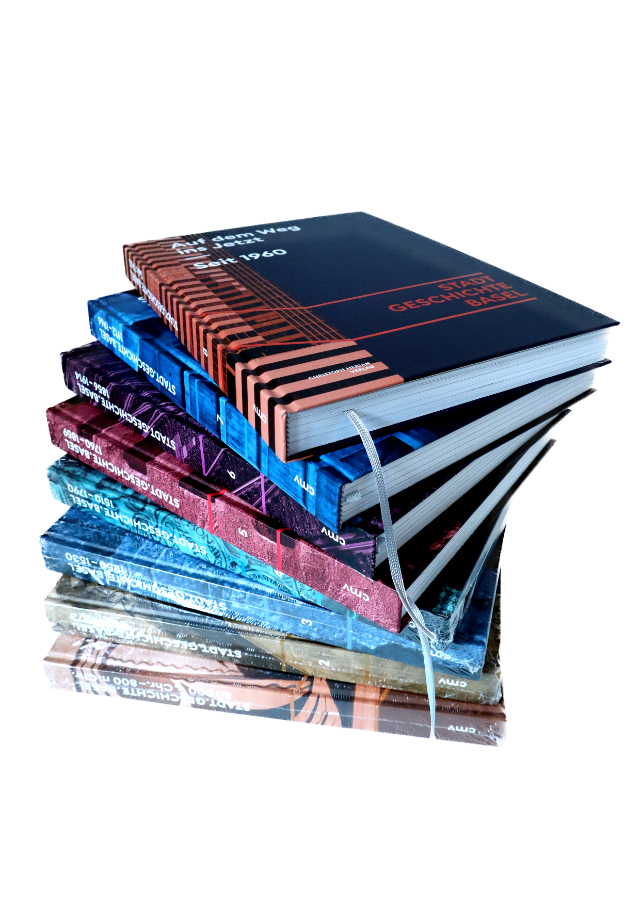
Stadt.Geschichte.Basel Podcast Folge 20
In der zwanzigsten Folge des Stadt.Geschichte.Basel Podcasts tauchen wir in zwei unterschiedliche Epochen ein. Wir schauen ins 19. Jahrhundert und erfahren mehr über die dritte jüdische Gemeinde in Basel. Im zweiten Teil springen wir ins 20. Jahrhundert und erfahren, warum ab den 1950er Jahren nochmals viele Kirchen gebaut wurden – und warum die Forschung trotzdem von einer Entkirchlichung spricht. von Ben Haab
SGBS Folge 20 Religion
...
Jüdisches Leben in Basel
Heute gehören Synagoge und Jüdisches Museum zum Stadtbild. Doch jahrhundertelang war jüdisches Leben aus Basel verschwunden. Zwar gab es bereits im 14. Jahrhundert eine jüdische Gemeinde. Diese wurde allerdings vertrieben. Während vierhundert Jahren lebten in Basel offiziell keine Menschen jüdischen Glaubens.
Erst im 19. Jahrhundert bildete sich eine neue jüdische Gemeinde. Viele Jüdinnen und Juden kamen aus dem Elsass oder Baden. Ohne Bürgerrechte waren ihnen jedoch Zünfte, politische Ämter und soziale Teilhabe verwehrt.
Erst Bundesrecht setzte Basel unter Druck. Mit der Verfassung von 1866 wurde jüdischen Menschen die Niederlassungsfreiheit, ab 1874 auch Kultusfreiheit garantiert. Es entstand ein vielfältiges Gemeindeleben mit eigenen Bäckereien, Synagogen, Vereinen – und ab 1885 einem ersten Rabbiner auf Stadtboden.
Kirchenbau und Entkirchlichung
Im 20. Jahrhundert erlebte Basel einen regelrechten Kirchenbauboom: In den 1930er-Jahren entstanden sechs neue Kirchen, zwischen 1950 und 1964 sogar neun. Der Bau war Teil der Stadtentwicklung – in den meisten Quartieren gab es schlussendlich ein "Kirchenpaar" mit einer katholischen und eine reformierten Kirche.
Besonders für Katholik:innen war Sichtbarkeit in der reformierten Stadt wichtig – jahrhundertelang waren katholische Gottesdienste verboten. Die Marienkirche von 1886 war die erste katholische Kirche seit der Reformation.
Trotz der vielen Kirchenbauten verlor die Kirche zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung. Vereinsleben, das früher stark konfessionell geprägt war, verlor an Kraft. Die „Verkirchlichung des Raumes“ steht damit im Kontrast zur „Entkirchlichung der Gesellschaft“, wie es die Stadt.Geschichte.Basel beschreibt.

.png/jcr:content/magnolia-medium.png)

