Schwarz/Weiss 2023
Schwarz/Weiss ist das Radio X-Format, welches sich mit den Beziehungen Basels mit Afrika auseinandersetzt. Die sechste Ausgabe widmet sich der Basler Kolonialgeschichte, der Basler Rolle im Sklavenhandel und den aktuellen Diskursen zu Restitution und Wiedergutmachung. Ein breit aufgestelltes Team – unter ihnen der Musiker Manuel Gagneux und eine grosse Zahl von Gästen ermöglicht die hintergründige Sendereihe, welche auch als Podcast angeboten wird. Start ist am 11. März.
“Stadt der Profiteure“ titelte unlängst das deutsche Magazin Geo – und meinte damit Basel, welches als Handelsstadt einen Teil seines Reichtums dem aktiven Mittun im Sklavenhandel verdankt. Davon zeugen die herrschaftlichen Sitze hoch über dem Rhein, die heute, wie das Blaue Haus, der Verwaltung dienen. Doch gibt es nicht nur steinerne Zeugen, sondern auch Nachkommen jener Familien. Zu ihnen gehört u.a. Leonhardt Burckhardt, Basler Politiker und Professor an der Universität, der auf Radio X sehr persönlich Auskunft über diese Erbschaft gibt.
Ganz unterschiedliche Familiengeschichten und damit ganz unterschiedliche Sichtweisen bringen die Basler Autoren Martin R. Dean und Nicolas Ryhiner mit ihren Werken „Meine Väter“ und „Im Surinam“ zum Ausdruck; sie treffen in einem Gespräch aufeinander.
Zum Stand der Geschichtsforschung geben die Historiker:innen Susanna Burghartz und André Salvisberg von Stadt.Geschichte.Basel Auskunft. Weitere Ausgaben von Schwarz/Weiss – Basler Kolonialgeschichte beschäftigen sich mit den Sammlungen der Basler Museen, der Qualität der aktuellen Wirtschaftsbeziehungen mit Afrika, und dem Blick, der von dort auf Basel geworfen wird.

Sendungen vom 11. März bis 3. Juni 2023
Die Schwarz/Weiss-Sendungen sind in folgende Schwerpunkte unterteilt:
1. Auftakt-Sendung: HörboX am 11. März (Wiederholung am 12. März)
2. Familiengeschichten mit kolonialem Hintergrund: Beitrag am 16. März
3. Der Basler Sklavenhandel: Beitrag am 23. März
4. Was findet sich in den Archiven?: Beitrag am 30. März
5. Gespräche mit Basler Familien: Beitrag am 6. April
6. Sammlungsprovenienzen & Benin Initiative Schweiz: Beitrag am 13. April
7. Heutige kulturelle Blicke und Austausch: Beitrag am 27. April
8. Rolle der Basler Mission: Beitrag am 4. Mai
9. Basels Handel heute: Beitrag am 11. Mai
10. Der Blick von Afrika auf Basel: Beitrag am 18. Mai
11. Brennpunkte und Forderungen der Gegenwart: Beitrag am 25. Mai
12. Schlussveranstaltung: HörboX am 3. Juni (Wiederholung am 4. Juni)
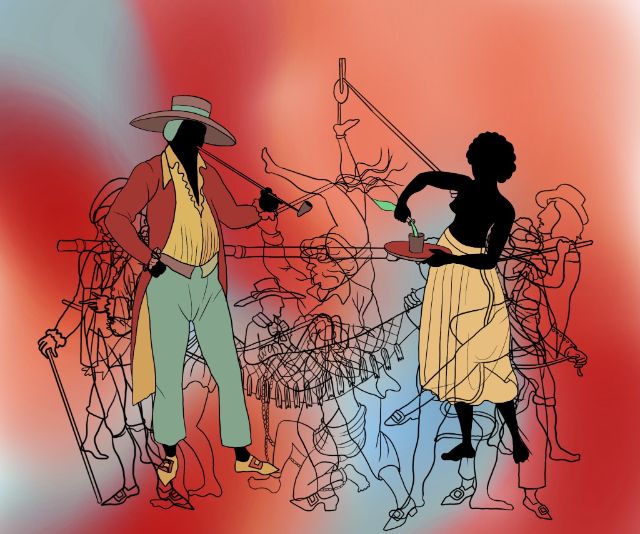
Projektteam, Kooperationen und finanzielle Unterstützung
Seitens Radio X sind Thomas Jenny, Danielle Bürgin, Janina Labhardt, Claire Micallef, Michaela Liechti, Mirco Kämpf und Paul von Rosen als Redaktionsteam unterwegs. Moderatorin ist Elisa Da Costa, Master-Studentin African Studies.
Das Artwork besorgte die Basler Künstlerin Sade Titilayo Hannah Fink, die Textildesign und Modedesign im Bachelor an der FHNW/HGK in Basel abschloss und nun Kunst & Vermittlung studiert.
Das Soundlayout zur Sendereihe wurde von Musiker Manuel Gagneux komponiert, dessen international gefeierte Band Zeal & Ardor das Thema musikalisch spiegelt.
Mit der freundlichen Unterstützung der Bürgergemeinde der Stadt Basel und der eidgenössischen Fachstelle für Rassismusbekämpfung.

Was tun diese Schweizer Festivals für unsere Zukunft?
Festivals sind mehr als Musik – sie spiegeln Zeitgeist, Träume und zunehmend auch ökologische Verantwortung. Doch wie gelingt nachhaltiges Feiern wirklich? Ein Blick auf vier kleine Festivals in der Schweiz, die neue Wege gehen. von Mirco Kaempf
25.07.15 Kleine Festivals und Nachhaltigkeit
Die Schweiz gilt immer noch als eines der Länder mit der höchsten Festivaldichte weltweit. Kein Wunder also, dass Festivals hierzulande oft als kulturelle Seismografen dienen – Orte, an denen sich der Zeitgeist beobachten lässt, an denen Unterhaltung, Gesellschaftspolitik und Zukunftsvisionen aufeinandertreffen. Vor allem im alternativen Bereich versprechen Musikfestivals oft eine Art von Utopie. Doch dieses Versprechen hat seinen Preis.
Wenn riesige Bühnen auf leere Felder transportiert werden, Dieselgeneratoren laufen und Essen in Einwegplastikschalen serviert wird, entstehen nicht nur eindrückliche Bilder – sondern auch messbare Umweltauswirkungen. Die Müllberge auf den Campingplätzen am Tag danach sind in unser mediales Gedächtnis gebrannt, besonders kritisch wird es jedoch bei den weniger offensichtlicheren Auswirkungen, so vor allem bei den CO₂-Emissionen durch An- und Abreise, die in der Regel kaum mit dem öffentlichen Verkehr erfolgt. Je grösser das Festival, desto grösser die Belastung.
Der 2023 erschienene Dokumentarfilm „Musikfestivals: Zwischen Aktivismus und Greenwashing“, produziert von Music Declares Emergency Switzerland, zeigt einige der Massnahmen, mit denen Schweizer Festivals gegensteuern: Das Openair Frauenfeld ersetzt zwei von 18 Dieselgeneratoren durch Batterien, das Openair Zürich verkauft Secondhand-Kleidung, und am Montreux Jazz Festival fischen freiwillige Helfer:innen Müll aus dem Genfersee – und erhalten dafür Kaffee und Gipfeli vom Festival.
Doch ist das alles nur Greenwashing? Oder sind es erste, wichtige Schritte? Diese Frage stellen die Regisseurinnen Daniela Weinmann und Céline Werdelis in den Raum. In diesem Beitrag wollen wir den Blick auf vier kleinere Schweizer Festivals richten, die das Thema Nachhaltigkeit auf ihre ganz eigene Art angehen – denn Wandel beginnt oft im Kleinen.
Summerfest im Terrain Gurzelen (Biel)
Zwischennutzung trifft Musikfestival: Seit bald zehn Jahren findet in Biel das Summerfest statt – ein alternatives Musikfestival im ehemaligen Fussballstadion des FC Biel, das heute als kreatives Zwischennutzungsprojekt dient. Das Terrain Gurzelen ist inzwischen Heimat für Gärten, Musikstudios, Ateliers, Tennisplätze und ist kurz gesagt ein Ort für kollektive Ideen und gelebte Nachhaltigkeit.
Matthias Rutishauser, einer der Mitorganisatoren, betont die starke Verankerung in der Community: Alles geschieht ehrenamtlich, das Booking ist dezentral organisiert, die Bühnen werden von verschiedenen Gruppen kuratiert. Besucher*innen kommen meist zu Fuss, mit dem Velo oder per ÖV. Plastikbecher gibt es zwar – aber mit Pfandsystem. Die grösseren Bühnen werden von aussen gebracht und aufgebaut, der Rest bleibt minimal. Nachhaltigkeit sieht man hier vor allem als Community Arbeit.
Cycloton - Tour de Suisse en Musique
Ein Festival welches auf dem Fahrrad Platz hat: Hinter dem "Cycloton" Projekt steht Schlagzeugerin und Aktivistin Béatrice Graf (u.a. bekannt von Ester Poly), die gemeinsam mit Musiker Domi Chansorn und wechselnden Gästen durch die Schweiz tourt – per Velo. Während drei Wochen im Juli radeln sie von Ost- nach Westschweiz, geben Konzerte mit regionalen Musiker*innen, und der Strom fürs Konzert wird live erradelt.
Mit dabei sind Künstler:innen wie Odd Beholder, Donat Kaufmann, Sebastian Rotzler oder Claudia Masika. Der Cycloton ist ein Statement gegen den Gigantismus und für regionale, klimafreundliche Kultur – und ein konkreter Appell, Tourneen lokal zu denken. Auch hier sei neben grünem Strom Community wichtig, sie beschreibt diese Konzertorte auch als Safer Spaces, um miteinander Momente zu teilen. Diese Woche machen sie Halt in Zofingen (Donnerstag), Huttwil (Freitag), Solothurn (Samstag) und Langnau (Sonntag).
Festival Landskron (Basel-Leymen)
Hier ist die Natur Teil des Lineups: Das Festival Landskron ist wahrscheinlich das spartanischste und gleichzeitig eines der exquisitesten Formate in der Schweizer Festivallandschaft. Es findet einmal jährlich mit nur rund 120 Besucher*innen statt – auf einer Wanderung von Basel über die Landesgrenze nach Leymen zur Burg Landskron.
Alexandra Adler und Sandro Bernasconi, die das Festival organisieren, kuratieren Musik und Kunst als Teil eines Erlebnisses in der Natur – oft mehrsprachig, immer experimentell. Neben Konzerten gibt es Beiträge von Fachpersonen aus den Bereichen Landwirtschaft, Naturschutz und Politik. Alles ist handverlesen, hochwertig und bewusst minimalistisch. Im Zentrum stehen persönliche Begegnungen, zwischen den Künstler:innen und den Besucher:innen. Die nächste Ausgabe findet am Sonntag, 31. August statt - und ist bereits ausverkauft.
One Of A Million Festival (Baden)
Das klimaneutrale Indoor-Festival: Seit 2017 ist das One Of A Million Festival (OOAM) klimaneutral – und seit 2019 ist Fabian Mösch Teil der Festivalleitung. Das Festival nutzt verschiedene Spielorte in der Stadt Baden und denkt Nachhaltigkeit konsequent mit: Strom stammt aus lokaler Wasserkraft, ÖV-Tickets sind im Eintritt enthalten, und das Booking wird unter klimapolitischen Gesichtspunkten geplant.
Das Festival setzt nicht nur auf ökologische, sondern auch auf soziale Nachhaltigkeit. Diversität, niederschwelliger Zugang, soziale Werte und bewusster Umgang mit Machtstrukturen stehen im Zentrum. Das OOAM versteht sich als Plattform für kulturelle und gesellschaftliche Möglichkeiten – ein Ort der gelebten Haltung.
Kleine Festivals, grosser Impact?
Man kann sagen: All diese Initiativen sind nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Solange Kriegsmaschinerien laufen, fossile Industrien subventioniert werden und soziale Ausbeutung Alltag ist, scheint der Einfluss von Festivals verschwindend gering. Doch das wäre zu einfach. Denn Festivals erreichen viele Menschen – und sie setzen Trends. Was bei kleinen Veranstaltungen beginnt, landet später auf den grossen Bühnen. Stars wie Billie Eilish setzen sich heute für nachhaltigere Tourbedingungen ein. Aber oft waren es die kleinen, engagierten Formate, die zuerst gehandelt haben.
Laut dem Nachhaltigkeitsbericht von Music Declares Emergency (2022) entfallen rund 67 % der CO₂-Emissionen von Schweizer Festivals auf die An- und Abreise von Besucher:innen und Künstler:innen. Danach folgen Verpflegung und Strom. Die Botschaft ist klar: Kultur braucht Energie – aber ein bewussterer Umgang ist möglich und notwendig. Denn: Wofür musizieren, wenn man nicht an eine Welt glaubt, die morgen noch existiert?


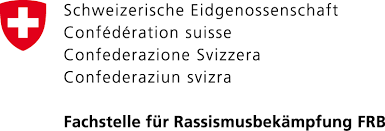






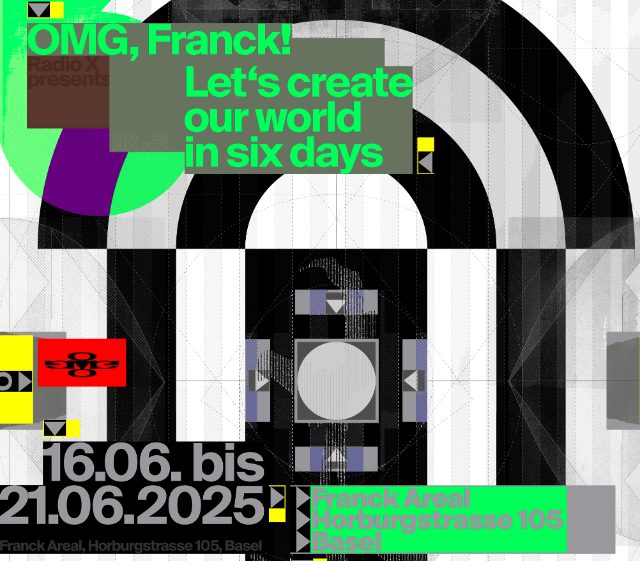

.png/jcr:content/magnolia-medium.png)

