
Aktionswoche gegen Rassismus 2024
Dank der finanziellen Unterstützung der kantonalen Fachstelle Integration und Antirassismus und der eidgenössischen Fachstelle für Rassismusbekämpfung organisiert Radio X im Rahmen der Aktionswoche gegen Rassismus vom 18. bis 24. März 2024 die Auftaktveranstaltung zum Thema Alltagsrassismus sowie ein vielseitiges Radioprogramm.
Podiumsdiskussion über Alltagsrassismus am Montag, 18. März ab 18h im kHaus
mit einer Begrüssung von Jenny Pieth (Co-Leiterin der Fachstelle Integration und Antirassismus), Inputreferat Danielle Isler (Sozialwissenschaftlerin Universität Bayreuth), Podiumsdiskussion mit Stéphane Laederich (Rroma Foundation), Guilherme Bezerra (brasilianischer Medienschaffender) und Danielle Isler. Moderiert von Elisa da Costa (Gründerin Blackfluencers und Afrokaana). Anschliessend Fragen aus dem Publikum plus Apéro.
Darüber hinaus bietet Radio X in der Aktionswoche ein randvolles Radioprogramm mit antirassistischen Beiträgen:
Mo, 18.3.: Info, was in der Aktionswoche ansteht
Di, 19.3.: Antisemitismus
Mi, 20.3.: Rassismus im Cosplay
Do, 21.3.: Sans Papier - eine Stimmungsaufnahme
Fr, 22.3.: FCB-Antirassismuskampagne
Sa, 23.3.: Racial Profiling
So, 24.3.: Rassismus auf der Wohnungssuche
Zudem arbeiten viele Partnerorganisationen in Kooperation mit der kantonalen Fachstelle Integration und Antirassismus:


Kontakt
Social Media
Mit der finanziellen Unterstützung von:

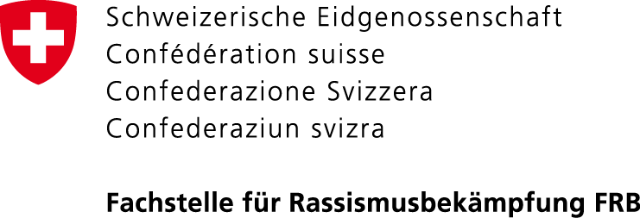
The Y xperienZ: Nur Ja heisst Ja
Im Zusammenhang mit der Revision des Sexualstrafrechts präsentierte Amnesty International gestern die Ergebnisse einer Studie mit dem Titel «Wahrnehmung sexuelle Beziehung und Gewalt». Bei der Frage nach dem besten Schutz vor sexueller Gewalt, erlangte die «Nur-Ja-heisst-Ja»-Lösung» dabei am meisten Zustimmung. Doch die Befragung macht auch problematisches Verhalten und Einstellungen klar ersichtlich. Wir haben darüber gesprochen.
Aktuell gilt in der Schweiz das sogenannte Nötigungsprinzip. Dieses besagt, dass ein sexueller Übergriff dann strafbar ist, wenn dabei eine weibliche Person zur Duldung des Beischlafs genötigt wird. Konkret heisst das: Bei der Tat muss entweder Gewalt angewendet oder eine Drohung ausgeführt worden sein, dass es zu einer Verurteilung kommen kann.
Nun soll das Sexualstrafrecht revidiert werden. Dafür hat die Kommission für Rechtsfragen des Ständerats (RK-S) einen entsprechenden Entwurf erarbeitet und diesen im Februar in die Vernehmlassung geschickt. Der Entwurf enthält unter anderem die Anpassung, dass künftig auch Opfer männlichen Geschlechts vom Tatbestand der Vergewaltigung erfasst werden können. Und auch der Begriff der Vergewaltigung soll allgemein erweitert werden. Neu wäre eine Vergewaltigung dann begangen, wenn gegen den Willen einer Person Beischlaf vorgenommen wird – auch ohne, dass dabei zum Beispiel Gewalt angewendet wird.
Auch spricht sich der Gesetzentwurf für die Anwendung der «Nein-heisst-Nein»-Lösung also des sogenannten Ablehnungsprinzips, anstelle des noch aktuell geltenden Nötigungsprinzips, aus. Das Ablehnungsprinzip besagt, dass eine Person kommunizieren soll, dass eine sexuelle Handlung nicht gewollt ist. Strafbar macht sich infolgedessen, wer gegen diesen Willen handelt.
Eine Kommissionsminderheit kritisierte diesen Punkt jedoch und forderte stattdessen die Anwendung des Zustimmungsprinzips, also der sogenannten «Nur-Ja-heisst-Ja»-Lösung. Diese beinhaltet, dass es die explizite Zustimmung zu einer sexuellen Handlung benötigt, bevor sie vollzogen werden darf. Denn laut den Befürworter:innen des «Nur-Ja-heisst-Ja»-Prinzips sei bei einer Vergewaltigung eine Art Schockstarre oftmals die natürliche körperliche Reaktion. Weiter müssten die Täter:innen die Betroffenen nur selten mit physischer Gewalt, Drohung oder anderen Mitteln zum Geschlechtsverkehr zwingen. Somit sei nicht der Zwang, sondern die fehlende Zustimmung bei einer Vergewaltigung das entsprechende Kriterium. Die beauftrage Kommission lehnte den Antrag bezüglich des Zustimmungsprinzips jedoch mit neun zu vier Stimmen ab.
Im Zusammenhang mit der Revision des Sexualstrafrechts veröffentlichte Amnesty International Schweiz gestern die Ergebnisse einer Studie mit dem Namen «Wahrnehmung sexuelle Beziehung und Gewalt», welche vom Forschungsinstitut gfs.bern im Auftrag von Amnesty durchgeführt wurde. Die Frage nach dem politischen Handlungsbedarf stellte dabei ein Schwerpunkt der Studie dar. Dabei stellte sich heraus, dass sich eine deutliche Mehrheit der Befragten für das «Nur-Ja-heisst-Ja-Prinzip» ausspricht. Andere Ergebnisse der Studie zu Fragestellungen wie «Welches Verhalten interpretieren Sie als Einwilligung des Gegenübers zum Geschlechtsverkehr» hingegen machten uns teilweise fassungslos.
Weitere Informationen, sowie unsere persönlichen Einordnungen und Gedanken zu der Thematik und den Umfragergebnissen, teilen wir in der Sendung. Auch behandeln wir in dieser Folge von The Y xperienZ einen dazu passenden Gerichtsfall, welche sich letzte Woche in Basel vollzogen hat.


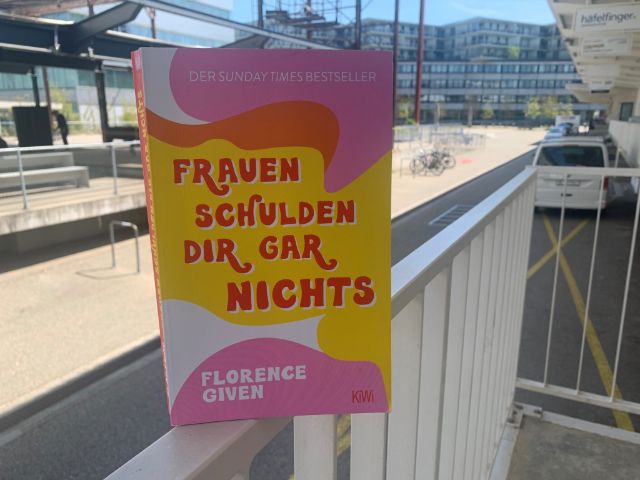



.png/jcr:content/magnolia-medium.png)

